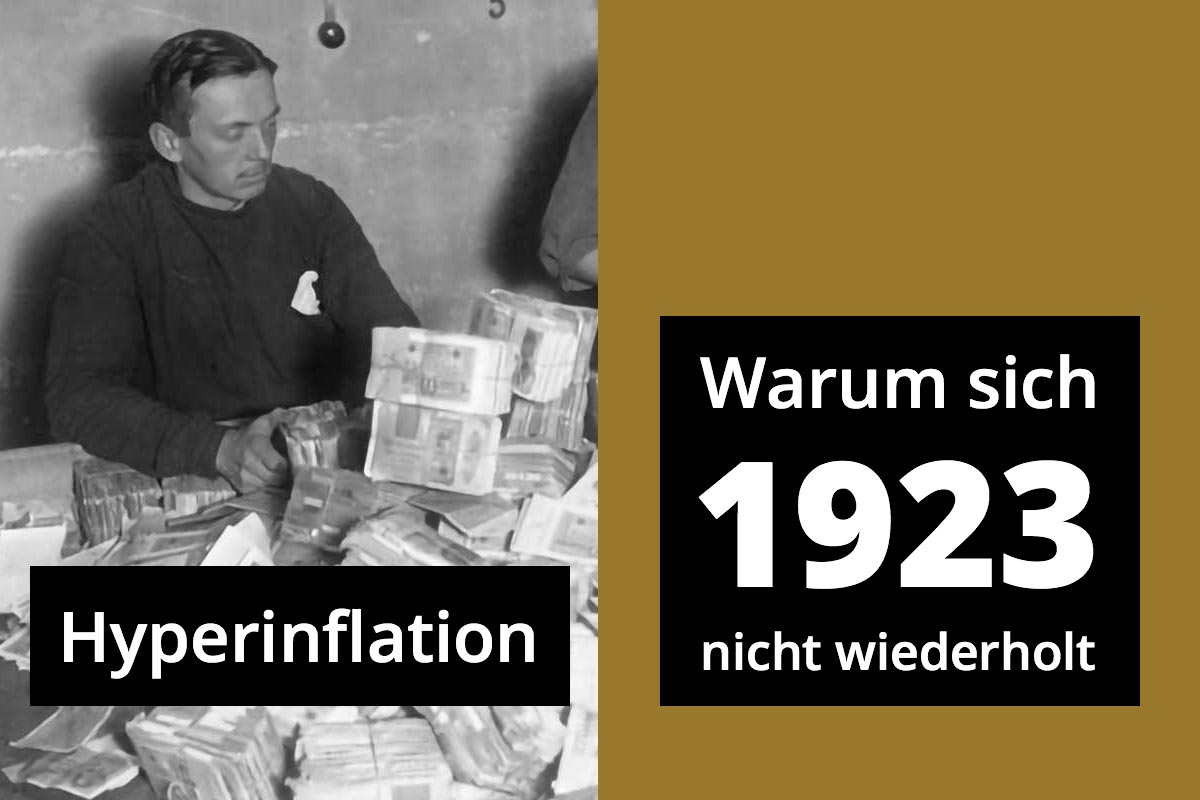| GOLD | 2.387,03 $/oz | 2.199,13 €/oz | 70,70 €/g | 70.704 €/kg |
| SILBER | 27,91 $/oz | 25,73 €/oz | 0,83 €/g | 827,24 €/kg |
-
Kaufen
- EDELMETALLE KAUFEN
- GOLD PREISVERGLEICH
- Gold kaufen
- Goldmünzen
- Goldbarren
- SILBER PREISVERGLEICH
- Silber kaufen
- Silbermünzen
- Silberbarren
- WEITERES
- Platin
- Palladium
- Weitere Metalle
- Münzzubehör
-
Verkaufen
- EDELMETALLE VERKAUFEN
- GOLD VERKAUFEN
- Goldankauf
- Goldmünzen
- Goldbarren
- Goldankauf Rechner
- SILBER VERKAUFEN
- Silberankauf
- Silbermünzen
- Silberbarren
-
Händler
- Händler Übersicht
- GOLDHÄNDLER
- Deutschland
- Österreich
- Schweiz
- GOLD.DE ZERTIFIZIERT
- Das Siegel für mehr Sicherheit
- Kurse
- Magazin
- Magazin Übersicht
- AKTUELLES
- Kurznachrichten
- Neue Münzen & Motive
- Videos
- HINTERGRÜNDE
- Gold Fakten
- Wissen
- Tipps
- Themen
- GOLD.DE Interviews
- Autoren von GOLD.DE
- Ratgeber
- Ratgeber Übersicht
- FÜR EINSTEIGER
- Warum GOLD.DE?
- Gold kaufen: So investieren Sie richtig
- Online kaufen & verkaufen - so geht’s
- Anonym kaufen - das Tafelgeschäft
- Häufig gestellte Fragen
- TOP RATGEBER
- Steuern auf Edelmetalle
- Schnell erklärt: Unze / Feinunze
- Sicher Gold lagern
- Echtheit von Gold prüfen
- Goldsparplan
- Service
- Service Übersicht
- INFORMATIONEN
- Magazin
- Kurznachrichten
- Ratgeber
- Service Übersicht
- TOOLS
- Aufgeldtabelle
- PDF Preislisten
- Jaeger-Nummer Suche
- Produkt Detailsuche
- Fakeshop Blacklist
- GOLD.DE-Trend-Tools
- SERVICE
- Jobbörse NEU
- Termine Münzmessen
- Termine Münzauktionen
- Münzen nach Ländern
- Kurse für Ihre Webseite
- COMMUNITY
- GOLD.DE Forum
- SILBER.DE Forum
Stand: 20.02.2024Was ist Inflation und wie hoch ist die aktuelle Inflationsrate? Wer profitiert davon, wer hat Nachteile? Ab wann ist Inflation gefährlich und wie kann ich mich schützen? Antworten inklusive Inflationsrechner hier.Aktuelle Inflationsrate Deutschland
2,20 % im Juni 2024Entwicklung Inflationsrate 6 MonateDezember 23 Januar 24 Februar 24 März 24 April 24 Mai 24 3,70 % 2,90 % 2,50 % 2,20 % 2,20 % 2,40 % Veränderungsrate in % zum VorjahresmonatQuelle: Statistisches BundesamtErgebnis KaufkraftverlustEin Geldbetrag von 1.000,00€ hat bei einer jährlichen
Inflationsrate von 2.20% in 5 Jahren noch eine Kaufkraft von:896,90 EURDies entspricht einem Kaufkraftverlust von 10,31% Prozent.Ergebnis PreissteigerungEin Produktpreis von 1.000,00€ erhöht sich bei einer jährlichen
Inflationsrate von 2.20% in 5 Jahren auf:1.114,95 EURDies entspricht einer Preissteigerung von 11,49% Prozent.Entwicklung Inflation Deutschland
Entwicklung Veränderungsrate zum Vorjahresmonat in %
Inflation: Das Wichtigste in Kürze- Inflation = allgemeiner Preisanstieg
- Synonym auch "Geldentwertung" oder "Kaufkraftverlust" genannt
- Jahresdurchschnitt 2023 bei 5,9 %
- Fünfthöchster Jahresdurchschnitt seit 1950
- Jahresdurchschnitt 2022 bei 6,9 %
Lies hier:Aktuelle Inflation Deutschland
Ende November 2023 lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Inflationsrate bei 3,2 %. Der Preisanstieg versteht sich im Vergleich zum Vorjahresmonat, also November 2022. Es handelt sich dabei um vorläufige Zahlen des sogenannten Verbraucherpreisindex (VPI).
Zu noch geringeren Werten kommt der sogenannte Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HPVI). Dieser weist für November eine Inflation von nur 2,3 % aus. Der HPVI wird seit einigen Jahren zusätzlich zum VPI ausgewiesen und wurde eingeführt, um innerhalb der EU für alle Länder eine einheitliche Datengrundlage zu haben. Die Berechnung des HPVI unterscheidet sich vom VPI.
Damit setzt sich die rückläufige Tendenz fort, die seit Monaten zu beobachten ist:
 Entwicklung Verbraucherpreisindex 2023 in Deutschland auf Monatsbasis
Entwicklung Verbraucherpreisindex 2023 in Deutschland auf MonatsbasisVerantwortlich für den Rückgang waren vor allem gesunkene Energiekosten. Gleichwohl ist das Preisniveau noch immer hoch. Aus Verbrauchersicht besonders negativ sind die Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln. Hier lag die Teuerung bei 5,5 %.
Entwicklung
Vergleicht man die Entwicklung der Inflation in Deutschland der letzten Jahre auf Jahresbasis, so ist festzuhalten, dass die Inflation meist zwischen 1 % und 2 % lag. Damit bewegte sich die Inflation im gewünschten Rahmen. Denn die Zielvorgabe der Europäischen Zentralbank sieht eine Inflationsrate von "knapp unter 2 %" vor. Etwas Inflation ist also erwünscht und normal:
 Vergleich Inflationsentwicklung in Deutschland auf Jahresbasis 2006 - 2022.
Vergleich Inflationsentwicklung in Deutschland auf Jahresbasis 2006 - 2022. Damit widerlegt obige Grafik die gelegentlich zu findende plakativ-verkürzte Darstellung, "Geld drucken" allein führe zwangsläufig zu hoher Inflation. Eine Auffassung, die im Gefolge der Finanzkrise ab 2008 in bestimmten Kreisen gern propagiert wurde. Richtig ist: In jener Zeit begann die EZB mit einer massiven Erhöhung der Geldmenge. Die Staatsverschuldung wuchs stark an. Ein starker Anstieg der Inflation ist aber in den Folgejahren nicht zu erkennen. Im Gegenteil: Die Inflation blieb nicht nur im gewünschten Rahmen, sondern lag über weite Phasen sogar niedriger als zu DM-Zeiten, wo Inflationsraten von 3 oder 4 % die Regel waren.
Ein sprunghafter Anstieg der Inflation ist erst mit der Coronakrise 2021 und den dadurch bedingten unterbrochenen Lieferketten zu verzeichnen. Ein weiterer deutlicher Anstieg erfolgte mit Beginn des Ukrainekriegs Anfang 2022.
Im Jahresvergleich ergibt sich somit für das gesamte Jahr 2022 eine durchschnittliche Inflationsrate von 6,9 %. Das ist der höchste Wert seit 1949.
Was ist überhaupt Inflation?
Frau Meier kauft im Supermarkt Kartoffeln. Die Preise sind gestiegen. Auf dem Weg nach Hause erfährt sie, dass auch ihr Friseursalon und die Tankstelle die Preise erhöht haben. Daheim angekommen, teilt ihr ihre Versicherung mit, dass die Beiträge angehoben werden müssen. "Alles wird teurer", schimpft sie.
Womit Frau Meier bereits eine sehr gute Erklärung von Inflation gegeben hat. Denn wenn sich nicht nur der Preis für ein einzelnes Produkt erhöht, sondern das allgemeine Preisniveau, also die Lebenshaltungskosten insgesamt für Waren und Dienstleistungen, dann spricht man von Inflation.
Das Wort leitet sich ab vom lateinischen inflatio und bedeut "Aufblähen". Oder anders ausgedrückt: Geld verliert an Kaufkraft. Man bekommt weniger für dasselbe Geld.
Moderate Inflation erwünscht
Preisstabilität ist das oberste Ziel aller Zentralbanken. Preisstabilität gilt laut EZB-Statuten dann als gegeben, wenn eine moderate Inflation von knapp 2 % vorliegt. Dieser Wert gilt also als erwünscht. Begründung:
- eine leichte Inflation regt den Konsum an, was wiederum die Wirtschaft in Schwung hält
- ein komplex-dynamisches System wie eine Volkswirtschaft lässt sich so am besten steuern
Für die Geldmenge sind die Zentralbanken zuständig. Sie bringen Geld in Umlauf.
Die Geldmenge ist eine volkswirtschaftliche Größe und meint den gesamten Geldbestand, der nicht in den Händen von Banken ist. Dabei wird unterschieden in die Geldmengen M1, M2 oder M3.Dennoch: Auch wenn knapp 2 % Inflation erwünscht sind, so sollte, wer Geldvermögen hat, immer mit spitzer Feder rechnen. Denn auch eine Teuerungsrate von "nur" 1,9 % bedeutet, dass sich der Preis einer Ware in etwa 38 Jahren verdoppelt.
Ist Inflation gefährlich?
Hier muss differenziert werden. Inflation ist nur unter bestimmten Voraussetzungen gefährlich. Und auch nicht für alle. Es gibt Gruppen, die von Inflation profitieren. Denn gesamtgesellschaftlich betrachtet geht ja kein "Geld verloren", sondern es findet nur eine Umschichtung von Werten statt.
Die Frage muss also lauten:
Wer profitiert von Inflation, wer hat Nachteile?
Stark vereinfacht: Sparer und Gläubiger sind Inflationsverlierer; Schuldner sind Inflationsgewinner.Unter der Voraussetzung, dass die Inflationsrate höher ist als der vereinbarte Zins, dann werden nominale Geldvermögen wie etwa Sparguthaben auf Dauer entwertet. Auch Bargeld wird auf lange Sicht weniger wert, weil man sich weniger damit kaufen kann. Man spricht dann von Kaufkraftminderung oder Kaufkraftverlust. Sparer sind also von Inflation besonders benachteiligt. Entsprechendes gilt für Gläubiger, wenn der Kreditzins niedriger ist als die Inflationsrate.

Doch was für Sparer und Gläubiger ein Nachteil ist, stellt sich umgekehrt bei Schuldnern als Vorteil dar. Denn auch Schulden oder Kredite schmelzen weg. Von Inflation profitiert also ein verschuldeter Staat, wie auch Schuldner allgemein. Vorausgesetzt, die laufende Schuldentilgung kann sauber bedient werden und der vereinbarte Kreditzins liegt unter der Inflation.
Zu Inflationsgewinnern können auch große Unternehmen mit Preissetzungsmacht zählen. Höhere Preise werden dann einfach an die Kunden durchgereicht - nicht selten mit extra Gewinn. Davon profitieren wiederum Aktienbesitzer, die sich über üppige Dividenzahlungen freuen dürfen. So verbuchten allein die 40 deutschen DAX Unternehmen in 2022 einen Rekordgewinn von 172 Milliarden Euro 4 - trotz Rekordinflation. Für die Dividendensaison 2023 werden die 100 größten deutschen Unternehmen voraussichtlich die Rekordsumme von 62 Milliarden Euro ausschütten.5 Das sind 10 % mehr als im Vorjahr.
Auch innergesellschaftlich muss differenziert werden bei der Frage, ob Inflation gefährlich ist. Weite Bevölkerungsschichten haben kein Polster um sich Sachwerte wie Gold, Aktien oder Immobilien zu kaufen. Also Anlage-Assets, die sich nicht selten günstig entwickeln in Inflationsszeiten. Wer als Niedrigverdiener mit seinen Einkünften zum Monatsende bisher gerade noch so hinkam, für den kann es existentiell knapp werden. Hierin liegt viel soziale Sprengkraft.
Besonders gefährlich wird es, wenn Inflationsraten hoch bis extrem werden. Je nach Ausmaß spricht man von einer galoppierenden Inflation oder einer Hyperinflation. Insbesondere Hyperinflation führt schnell zum Totalverlust von Geldvermögen und zu großer Verarmung weiter Teile der Bevölkerung. Bekanntes Beispiel ist die Hyperinflation in der Weimarer Republik 1923, wo sich Preise quasi über Nacht verdoppelten. In der Spitze kostetet ein einziges Ei 320 Milliarden Reichsmark.
Aber selbst in jener Zeit gab es Inflationsgewinner. Clevere Geschäftsleute verschuldeten sich und erwarben dafür Grund, Immobilien oder Fabriken. Die Schulden waren irgendwann kaum das Papier wert, auf dem sie notiert waren. Was blieb, waren die Sachwerte. Große Firmenimperien entstanden so. Als Paradebeispiel gilt hierfür Stinnes 6. Ebenfalls profitiert hat der deutsche Staat. Er hatte sich während des 1. Weltkriegs hoch verschuldet und wurde nun quasi über Nacht schuldenfrei.
Mehr: Warum keine Hyperinflation wie in Deutschland 1923 droht
Kaufkraftentwicklung Deutschland: Vergleich Sparerzins - Inflationsrate
Für viele Ökonomen ist daher die reale Kaufkraftentwicklung relevanter als nur der Blick auf absolute Inflationswerte. Für den Bürger sei entscheidend, was unterm Strich bleibt.
Demzufolge kann auch bei einer Inflationsrate von beispielsweise 4 % ein Kaufkraftzuwachs erfolgen, nämlich dann wenn Löhne, Gehälter, Renten oder verzinste Geldanlagen im selben Zeitraum um 5 % wachsen. Umgekehrt wäre eine Inflationsrate von 1% nachteilig für Bürger, wenn Einkommen oder verzinste Anlagen nur um 0,5 % wachsen.
Hier ist aber anzumerken, dass das allgemeine Einkommensniveau oft der Inflationsentwicklung hinterher hinkt. Unternehmen oder Händler können ihre Preise schnell erhöhen. Tarifabschlüsse, Lohnverhandlungen oder Rentenanpassungen sind dagegen eine langwierige, weil stets politische Sache. Auch Banken sind nicht gerade schnell mit Zinsanpassungen zugunsten der Anleger.
Wie der Blick auf D-Mark Zeiten der Jahre 1975 oder 1980 zeigt, relativiert sich also die Aussage, wonach hohe Staatsverschuldung und damit verbundene Niedrig- oder Nullzins-Politik der Zentralbanken in besonderem Maße Sparer benachteiligen würden. Auch in Hochzinsphasen können Sparer einen realen Vermögensverlust erleiden. Der Verlust kann sogar noch höher ausfallen als in Niedrigzinsphasen:
Jahr Sparerzins (1) (2) Inflationsrate (3) Differenz (= reale Kaufkraftentwicklung) 2020 0,1 % 0,5 % - 0,4 2015 0,5 % 0,5 % +-0 2010 1,4 % 1,1 % + 0,3 2005 2,0 % 1,5 % + 0,5 2000 1,3 % 1,4 % - 0,1 1995 2,0 % 1,8 % + 0,2 1990 2,8 % 2,6 % + 0,2 1985 2,9 % 2,0 % + 0,9 1980 4,6 % 5,4 % - 0,8 1975 4,4 % 6,0 % - 1,6 Entstehung von Inflation
Dass die Geldmenge auf lange Sicht steigt ist normal. Zum einen wächst die Zahl der Menschen und somit die Nachfrage nach Waren. Zum anderen werden immer mehr Dinge und Dienstleistungen selbst zur "Ware", unterliegen also dem Geldkreislauf. Wir kaufen heute Dinge, die es so früher gar nicht gab: Das Auto, den Urlaub, die Internet-Flatrate, einen Kita-Platz, Kosmetikprodukte oder das monatliche Abo fürs Fitness-Studio.
Früher gab es viel weniger Waren, die Gesellschaft war weniger arbeitsteilig. Somit war auch weniger Geld im Umlauf. Man hat Kartoffeln nicht gekauft, sondern selbst angebaut. Man fuhr nicht mit dem Auto, sondern ging zu Fuß. Es wurde mehr getauscht; selbst Steuern wurden oft in Naturalien eingetrieben. Dass im Mittelalter ein Bauer etwas gegen Geld gekauft hat war im Vergleich zu heute extrem selten.
Die Geldmenge wächst also. In welchem Ausmaß aber dadurch Inflation in einer modernen Volkswirtschaft entsteht und wie man Inflation bekämpfen soll, darüber sind sich Ökonomen uneins.
Warum werden Waren und Dienstleistungen teurer? Kann Geld als abstrakte Verrechnungseinheit überhaupt "Wert verlieren"? Je nach akademischer Denkschule und politischem Hintergrund gibt es unterschiedliche Meinungen.Monetäre Inflationstheorien
Vertreter dieser Theorien sehen als wesentliche Ursache von Inflation die unkontrollierte Ausweitung der ungedeckten Geldmenge. Salopp formuliert: "Geld wird gedruckt". Steht aber die Geldmenge einer Volkswirtschaft nicht im passenden Verhältnis zur Gesamtmenge an Waren und Dienstleistungen, würde Geld weniger wert, das gesamte Preissystem wäre verzerrt. Im Umkehrschluss bedeute dies Preissteigerungen. Anhänger dieser Theorien finden sich insbesondere in neoliberalen und rechtskonservativen Ökonomenkreisen wie den "Monetaristen" oder der "Österreichischen Schule", wo ein mehr oder weniger starker Marktradikalismus propagiert wird. In diesem Lager wird auch gern über die (Wieder-) Einführung einer gedeckten Währung diskutiert in Form eines Goldstandards, welcher Geldentwertung vorbeugen solle.
Nichtmonetäre Inflationstheorien
Der Fokus der Betrachtung liegt hier weniger auf Geld, sondern auf dem dynamischen Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage sowie den Produktionsfaktoren. Um beim eingangs angeführten Beispiel zu bleiben: Preise für Kartoffeln können demzufolge auch steigen aufgrund von Missernten, also einer Angebotsknappheit. Oder weil der Bauer aufgrund unterbrochener Lieferketten seinen Traktor nicht reparieren kann. Oder weil erdölfördernde Länder die Rohölpreise angehoben haben. Oder weil aufgrund eines Trends die Nachfrage nach Kartoffeln explodiert.
Inflation Deutschland: Die Messung
Als mehrheitlich akzeptierte Grundlage gilt der repräsentative durchschnittliche Warenkorb. Dieser enthält etwa 650 Güter und Dienstleistungen, unterteilt in 12 Kategorien mit unterschiedlicher Gewichtung. Man nennt diese Zusammensetzung auch das Wägungsschema. Dieses Wägungsschema wird regelmäßig neu angepasst und kann hier eingesehen werden: www.destatis.com: Wägungsschema. Die letzte Anpassung erfolgte 2020.
Die Preise selbst werden monatlich ermittelt. In Deutschland macht die monatlichen Preiserhebungen das Statistische Bundesamt. Die ermittelten Preise werden dann in Bezug gesetzt zum Vorjahresmonat. Daran bemisst sich, ob die Inflationsrate gestiegen oder gefallen ist. Die Inflationsrate wird auch als Verbraucherpreisindex oder Lebenshaltungskostenindex bezeichnet. Preistreiber im Juni 2023 waren demzufolge Lebensmittel mit 13,4 % Teuerung:
 Veränderungen nach Gütergruppen Stand August 2023.
Veränderungen nach Gütergruppen Stand August 2023. Unschärfen bei der Messung sind grundsätzlich nicht vermeidbar. Das gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. So treffen etwa Mieterhöhungen nur Mieter. Steigende Spritpreise treffen vor allem Pendler und der Tabakpreis interessiert einen Nichtraucher nicht.
Diskutiert wird auch das Konzept der hedonischen Preisanpassung. Diese Berechnungsmethode wird angewendet zur Ermittlung der Preissteigerungsraten bei technologischen Gütern. Dahinter steht die Überlegung, dass Preiserhöhungen auch den technischen Fortschritt berücksichtigen müssen. Nach dieser Logik kann ein zur Inflationsberechnung herangezogener Preis für die Gattung "haushaltsüblicher PC" sogar niedriger ansetzt werden im Vergleich zur Vorperiode, obwohl der reale Ladenpreis gestiegen ist. Begründet wird dies damit, dass man umgerechnet mehr Ware bekäme, etwa weil der neue PC mehr Prozessorleistung hat. Damit, so Kritiker, lassen sich Inflationsraten "schönrechnen".
Alternative Berechnungen ermitteln dagegen die sogenannte monetäre Inflation. Hierbei wird vom Wirtschaftswachstum das Wachstum der ausgegebenen Geldmenge abgezogen. Diese Methode kommt zu höheren Inflationswerten.
Auch in der Diskussion ist die gefühlte Inflation. Viele Menschen glauben, dass die Inflation tatsächlich höher ist als die präsentierten Zahlen. Psychologisch lässt sich aber festhalten, dass der Mensch dazu neigt, Preiserhöhungen bei Produkten des alltäglichen Bedarfs deutlicher "wahrzunehmen" als etwas, das man nur alle 10 Jahre kauft. Bekanntestes Beispiel ist das berühmte Pfund Butter im Supermarkt. Preisveränderungen bei selten gekauften Gütern werden dagegen weniger stark wahrgenommen, selbst wenn sie stabil sind oder gar fallen. Dies sind aber oft hochpreisige Güter wie eine Waschmaschine oder Sofagarnitur.
Schutz vor Inflation: Was kann ich tun?
Als Schutz vor Geldentwertung bieten sich generell Sachwerte an. Dazu zählen Edelmetalle, Immobilien oder Aktien.
Gold bietet langfristig einen relativ guten Inflationsschutz, aber keine Garantie. Ein Totalverlust von Wert, etwa im Gefolge einer Hyperinflation, ist bei Gold jedoch so gut wie ausgeschlossen.Je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis empfiehlt es sich, 5 -15 % des persönlichen Vermögens in physisches Gold wie Barren und Bullionmünzen anzulegen. Sammlermünzen sind auch ein guter Inflationsschutz, setzen aber Fachkenntnisse voraus.
Quellen
- Statista: Entwicklung durchschnittlicher Zinssatz für Spareinlagen 1975 - 2018
- Bundesbank: Zinssätze Einlagen privater Haushalte 2019 (gerundet)
- Statista: Inflationsraten in Deutschland von 1950 bis 2019
- "Die Konzerne verdienen so viel wie nie" In: Süddeutsche Zeitung, 23. März 2023
- "Studie: Deutschlands Top-100-Unternehmen schütten Rekord-Dividenden aus" In: ntv, 16. März 2023
- "Der König der Inflation" In: DIE ZEIT, 6. 5. 1999, abgerufen 12.9.2023
Ihre Meinung zum Thema?von säger | 05.11.2022, 14:22 Uhr AntwortenMeine Betriebsrente erhöht sich jährlich um 1%, d.h. bei 10% Inflation. Mein Verlust 9%, fließt 1:1 in die Taschen der Kreditnehmer, von Investoren, die am Kapitalmarkt aktiv sind, in die Taschen der Reichen eben. Millionen von Betriebs - und Riesterrenten sind genauso betroffen. Den Klein - Rentnern und Rentnerinnen wird das Wasser abgegraben und auf die Mühlen der Reichen geleitet. Statt Vorsorge fürs Alter, Umverteilung von unten nach oben. Durch politischen Willen die Sozialpolitik auf den Kopf gestellt! Bravo Volksvertreter!
von mmm | 17.04.2020, 21:04 Uhr AntwortenWomöglich habe ich einen Denkfehler und verstehe das hier falsch! Nachdem der Euro eingeführt wurde, haben sich die Preise oft zum gleichen Betrag (Produnkt vorher 1 DM jetzt 1 Euro) bzw. oft auch zu mehr gewandelt. Hingegen wurde das Gehalt nicht 1 zu 1 übernommen. Außerdem reduzieren viele Hersteller ihre Mengen, bei gleichem Preis! Ist das dann nicht auch so etwas, wie Inflation? Zumindest für den Verbraucher...
2 Antworten an mmm anzeigenvon meerettich | 08.01.2021, 16:26 Uhr AntwortenInflation wirkt sich aus wie eine nachträgliche Kürzung gesparter Löhne von gestern. Man könnte auch NICHT GESETZLICHE, geheime Steuer dazu sagen. Daran ändern verschiedene Betrachtungen des Inflations-Begriffes auch nichts.
Da es keinen verfassungsmäßig legitimierten €U Staat gibt, bleibt nichts andres über, als ordentliche Steuergesetze durch ungedeckte Kredit-Vergabe zu ersetzen. Besonders arglistig dabei ist, daß Verbraucher, Sparer und Steuerzahler die Inflation aus der Notenpresse erst dann spüren, wenn der „Kredit auf künftige Steuergesetze“ längst ausgegeben ist.
Der Bundestag verletzt seine Pflicht zur Gesetzgebung. Und die €ZB mutiert vom Stabilitätswächter zum NICHT GESETZLICHEN Steuer Eintreiber und Null-Zins-Verteiler für „arme“ Investoren
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 07:11:09 Uhr
 Entwicklung Verbraucherpreisindex 2023 in Deutschland auf Monatsbasis
Entwicklung Verbraucherpreisindex 2023 in Deutschland auf Monatsbasis Vergleich Inflationsentwicklung in Deutschland auf Jahresbasis 2006 - 2022.
Vergleich Inflationsentwicklung in Deutschland auf Jahresbasis 2006 - 2022. 
 Veränderungen nach Gütergruppen Stand August 2023.
Veränderungen nach Gütergruppen Stand August 2023.